Reichtum gerecht verteilen
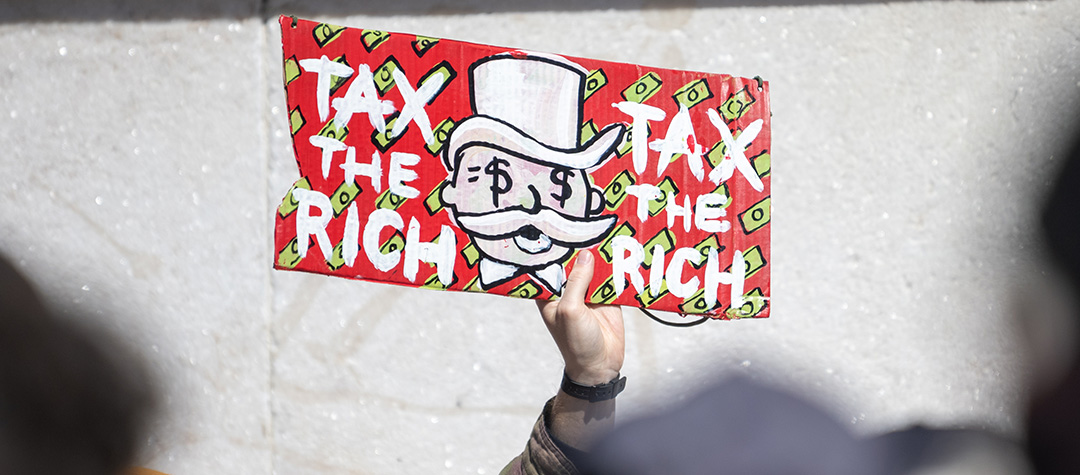
Vermögen sind in Deutschland sehr ungleich verteilt: Die zwei reichsten Familien besitzen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Das reichste 1 Prozent der Bevölkerung besitzt mehr als ein Drittel des Vermögens. Oft wird in der Politik darüber gesprochen, wo gespart und gekürzt werden muss, aber nicht darüber, auf welche Einnahmen verzichtet wird, wenn Reichtum nicht ausreichend besteuert wird. Wenn die Vermögensteuer wieder eingeführt würde, könnten bundesweit Schulen, Kitas, Krankenhäuser und sozialer Wohnungsbau besser finanziert werden.
Gerechte Einkommensteuer
Wir entlasten die, die viel leisten und wenig verdienen. Als Faustregel gilt: Wer weniger als 7.000 Euro brutto verdient, hat mit unserem Steuerkonzept mehr in der Tasche. Wer ein höheres Einkommen hat, zahlt dafür mehr Steuern. Wir finden: Das ist fair. Denn wer viel verdient, kann mehr beitragen.
Übergewinnsteuer einführen
Die Übergewinnsteuer ist ein Gebot sozialer Gerechtigkeit. Während viele Menschen in Deutschland nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen, machen viele Konzerne wegen der gestiegenen Preise Milliardengewinne. Wenn nur ein Teil der Einnahmen aus der Übergewinnsteuer in einen Schutzschirm für kommunale Energieversorger investiert würde, könnten Millionen Menschen entlasten werden.
Vermögensteuer
Wir wollen Vermögen (abzüglich Schulden) oberhalb von 1 Millionen Euro mit 1 Prozent besteuern. Bis zu einem Nettovermögen von 50 Millionen steigt der Satz auf 5 Prozent an. Für Betriebsvermögen gelten Freibeträge von mindestens 5 Millionen Euro. So hätten wir mehr Geld für den Ausbau von Bus und Bahn, für Schulen und Kitaplätze, für bessere Pflege und ein gerechtes und modernes Gesundheitssystem, für ein gutes Leben für alle. Geld ist genug da, es ist nur ungerecht verteilt!
In die öffentliche Infrastruktur investieren
Dem privaten Reichtum steht eine verarmte öffentliche Infrastruktur gegenüber: Bibliotheken und Schwimmbäder schließen, in Schulen fällt der Putz von der Decke und Personal im Krankenhaus wird gekürzt.
Wir werden jährlich über 120 Milliarden Euro in Bildung, Gesundheit, Energie- und Verkehrswende, sozialen Wohnungsbau, Kommunen und in die Schaffung und Rettung von Arbeitsplätzen investieren, damit in Zukunft genug Lehrkräfte unsere Kinder in guten Schulen und Kitas betreuen können, es genug Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen gibt und mindestens 250 000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr entstehen können. Wir werden erneuerbare Energien fördern sowie Bus, Bahn, Rad- und Fußverkehr ausbauen. Kommunen werden wir entlasten, benachteiligte Regionen fördern und mit einem Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze den notwendigen ökologischen Umbau in der Industrie sozial absichern.
Die Linke will ein gerechtes Steuersystem zur Finanzierung eines guten Gemeinwesens: Wer viel hat, muss auch viel beitragen. Wer wenig hat, wird entlastet. Denn es ist genug Geld da – es ist nur ungerecht verteilt.

Werde Lobbyist:in für Verteilungsgerechtigkeit
Da wir keine Spenden von Großkonzernen und Banken annehmen, brauchen wir Deine Unterstützung.
Wir fordern: ein gerechtes Steuersystem
- 1
Millionäre besteuern
Wir wollen Vermögen (abzüglich Schulden) oberhalb von 1 Millionen Euro mit 1 Prozent besteuern. Bis zu einem Nettovermögen von 50 Millionen steigt der Satz auf 5 Prozent an. Für Betriebsvermögen gelten Freibeträge von mindestens 5 Millionen Euro. - 2
Große Erbschaften konsequent besteuern
Die Superreichen können Millionenvermögen in Unternehmensanteilen steuerfrei vererben oder verschenken. Diese Steuerschlupflöcher wollen wir schließen und die Erbschaftssteuer auf hohe Erbschaften erhöhen. Normales selbstgenutztes Wohneigentum bleibt freigestellt. - 3
Spitzen-Einkommen und Manager-Gehälter stärker belasten
Untere und mittlere Einkommen wollen wir entlasten, Spitzen-Einkommen und Manager-Gehälter stärker belasten. Unsere Faustregel: Wer (als Single, Steuerklasse I) weniger als 7.000 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern. - 4
Einmalige Vermögensabgabe zur gerechten Verteilung der Krisenlasten
Diese soll für Nettovermögen über 2 Millionen Euro (für Betriebsvermögen sind 5 Millionen Euro Freibetrag) erhoben werden und kann in Raten über 20 Jahre abgezahlt werden. Die geschätzten Einnahmen liegen bei 310 Milliarden Euro. - 5
Konzerne besteuern
Die Körperschaftssteuer soll auf 25 Prozent erhöht werden. Managergehälter oberhalb von 500.000 Euro im Jahr dürfen nicht mehr als Betriebsausgaben steuerlich abgezogen werden. - 6
Gewerbesteuer zu Gemeindewirtschaftsteuer weiterentwickeln
Auch gutverdienende Selbständige und Freiberufler werden einbezogen. So können die Kommunen wieder auf verlässliche finanzielle Füße kommen. - 7
Steuerflucht unterbinden
Wir drängen auf europaweite Mindestsätze für Unternehmenssteuern, um Steueroasen auszutrocknen. Geldwäsche und Subventionsbetrug wollen wir durch wirksame Kontrollen bekämpfen.
Weiterlesen auf LINKS BEWEGT

Die Vermögensteuer: machbar, gut und richtig
Deutschland ist Hochsteuerland bei Steuern auf Arbeit, aber ein Steuerparadies für Großvermögende. Auf einer Fachtagung der Fraktion der Linken im…
Weiterlesen
Stopp dem großen Steuerraub!
Großvermögen und Konzerngewinne explodieren, während die breite Mehrheit belastet wird. Die Linke sagt: Schluss damit! In Berlin stellten…
Weiterlesen
Für einen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel
Symptombekämpfung reicht nicht mehr, wir brauchen einen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel. Er beginnt mit der Zurückverteilung des Reichtums.
WeiterlesenMeldungen und Meinungen zum Thema gerechte Steuern
Wo steht die Linke in der politischen Debatte? Hier geht es um aktuelle Positionen und Meldungen aus der Partei
Stromsteuer-Theater beenden - Mehrheit endlich entlasten
Zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses sagt Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die Linke:
Inside BlackRock: Studie wirft schlechtes Licht auf Merz
Zu den Enthüllungen über die Steuertricks von BlackRock im Rahmen der "Inside BlackRock"-Studie sagt Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die
Finanzminister Klingbeil macht FDP-Politik
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil fordert vom neuen Bundeskabinett weitere Einsparungen. Dazu meint Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die
Materialien herunterladen
 Ungleichheit und Reichtum (2/2025)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 290 KB
Ungleichheit und Reichtum (2/2025)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 290 KB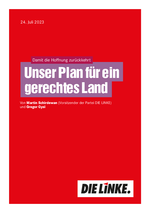 "Unser Plan für ein gerechtes Land" von Gregor Gysi und Martin Schirdewan (7/2023)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 529 KB
"Unser Plan für ein gerechtes Land" von Gregor Gysi und Martin Schirdewan (7/2023)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 529 KB Die Investitionsbremse muss weg (1/2023)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 544 KB
Die Investitionsbremse muss weg (1/2023)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 544 KB Kriegsgewinne besteuern (8/2022)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 394 KB
Kriegsgewinne besteuern (8/2022)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 394 KB Die Superreichen: Wie deutsche Milliardäre zu ihrem Vermögen kamen. (1/2022)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 11 MB
Die Superreichen: Wie deutsche Milliardäre zu ihrem Vermögen kamen. (1/2022)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 11 MB Für Bildung und Soziales: Vermögensteuern (9/2021)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 2 MB
Für Bildung und Soziales: Vermögensteuern (9/2021)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 2 MB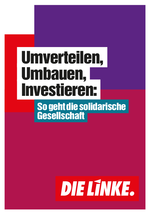 Umverteilen, Umbauen, Investieren (9/2021)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 546 KB
Umverteilen, Umbauen, Investieren (9/2021)
(Link öffnet ein neues Fenster)PDF 546 KB